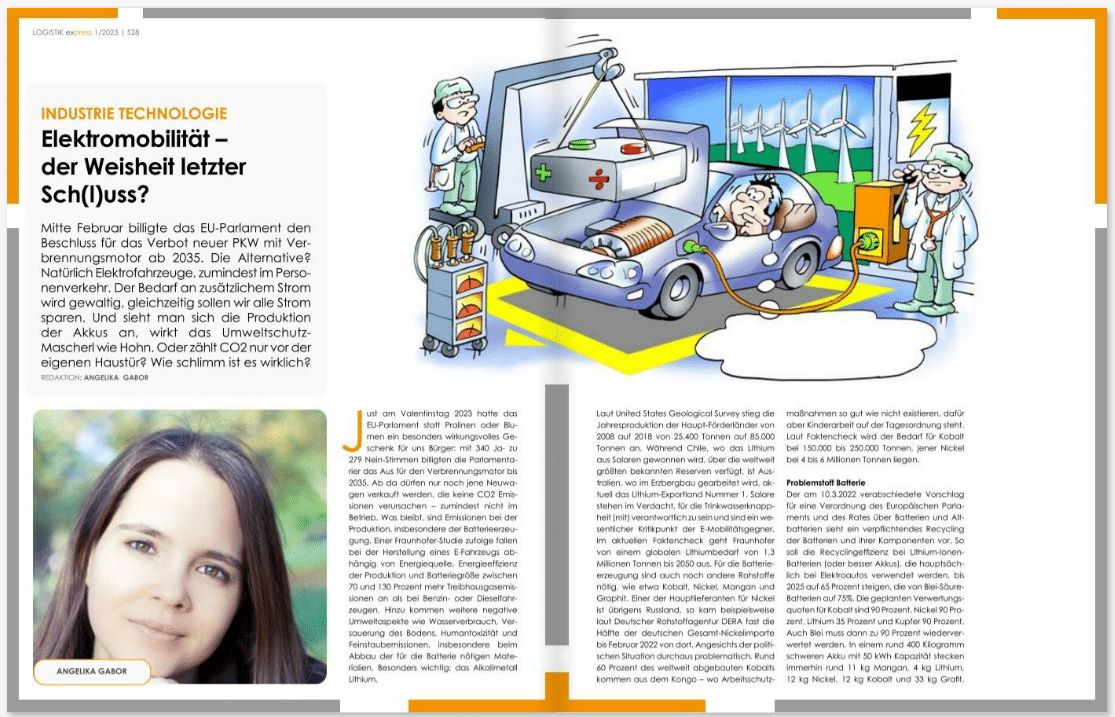Elektromobilität – der Weisheit letzter Sch(l)uss?
Mitte Februar billigte das EU-Parlament den Beschluss für das Verbot neuer PKW mit Verbrennungsmotor ab 2035. Die Alternative? Natürlich Elektrofahrzeuge, zumindest im Personenverkehr. Der Bedarf an zusätzlichem Strom wird gewaltig, gleichzeitig sollen wir alle Strom sparen. Und sieht man sich die Produktion der Akkus an, wirkt das Umweltschutz-Mascherl wie Hohn. Oder zählt CO2 nur vor der eigenen Haustür? Wie schlimm ist es wirklich?
Redaktion: Angelika Gabor.
Just am Valentinstag 2023 hatte das EU-Parlament statt Pralinen oder Blumen ein besonders wirkungsvolles Geschenk für uns Bürger: mit 340 Ja- zu 279 Nein-Stimmen billigten die Parlamentarier das Aus für den Verbrennungsmotor bis 2035. Ab da dürfen nur noch jene Neuwagen verkauft werden, die keine CO2 Emissionen verursachen – zumindest nicht im Betrieb. Was bleibt, sind Emissionen bei der Produktion, insbesondere der Batterieerzeugung. Einer Fraunhofer-Studie zufolge fallen bei der Herstellung eines E-Fahrzeugs abhängig von Energiequelle, Energieeffizienz der Produktion und Batteriegröße zwischen 70 und 130 Prozent mehr Treibhausgasemissionen an als bei Benzin- oder Dieselfahrzeugen. Hinzu kommen weitere negative Umweltaspekte wie Wasserverbrauch, Versauerung des Bodens, Humantoxizität und Feinstaubemissionen, insbesondere beim Abbau der für die Batterie nötigen Materialien. Besonders wichtig: das Alkalimetall Lithium.
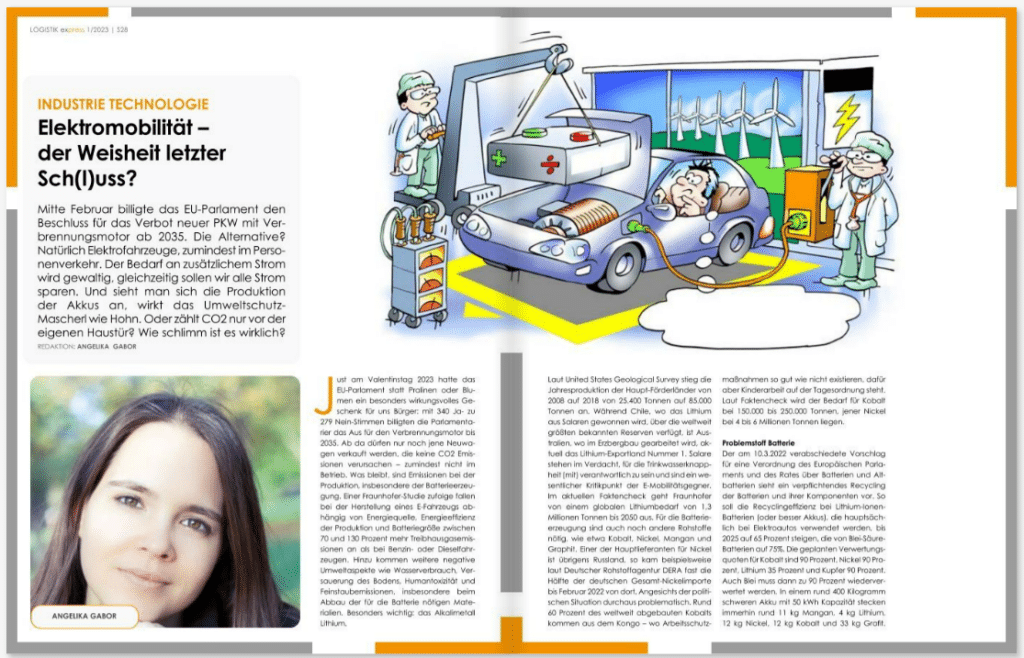
Laut United States Geological Survey stieg die Jahresproduktion der Haupt-Förderländer von 2008 auf 2018 von 25.400 Tonnen auf 85.000 Tonnen an. Während Chile, wo das Lithium aus Salaren gewonnen wird, über die weltweit größten bekannten Reserven verfügt, ist Australien, wo im Erzbergbau gearbeitet wird, aktuell das Lithium-Exportland Nummer 1. Salare stehen im Verdacht, für die Trinkwasserknappheit (mit) verantwortlich zu sein und sind ein wesentlicher Kritikpunkt der E-Mobilitätsgegner.
Im aktuellen Faktencheck geht Fraunhofer von einem globalen Lithiumbedarf von 1,3 Millionen Tonnen bis 2050 aus. Für die Batterieerzeugung sind auch noch andere Rohstoffe nötig, wie etwa Kobalt, Nickel, Mangan und Graphit. Einer der Hauptlieferanten für Nickel ist übrigens Russland, so kam beispielsweise laut Deutscher Rohstoffagentur DERA fast die Hälfte der deutschen Gesamt-Nickelimporte
bis Februar 2022 von dort. Angesichts der politischen Situation durchaus problematisch. Rund 60 Prozent des weltweit abgebauten Kobalts kommen aus dem Kongo – wo Arbeitsschutzmaßnahmen so gut wie nicht existieren, dafür aber Kinderarbeit auf der Tagesordnung steht. Laut Faktencheck wird der Bedarf für Kobalt bei 150.000 bis 250.000 Tonnen, jener Nickel bei 4 bis 6 Millionen Tonnen liegen.
Problemstoff Batterie
Der am 10.3.2022 verabschiedete Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über Batterien und Altbatterien sieht ein verpflichtendes Recycling der Batterien und ihrer Komponenten vor. So soll die Recyclingeffizienz bei Lithium-Ionen-Batterien (oder besser Akkus), die hauptsächlich bei Elektroautos verwendet werden, bis 2025 auf 65 Prozent steigen, die von Blei-Säure-Batterien auf 75%. Die geplanten Verwertungsquoten für Kobalt sind 90 Prozent, Nickel 90 Prozent, Lithium 35 Prozent und Kupfer 90 Prozent. Auch Blei muss dann zu 90 Prozent wiederverwertet werden. In einem rund 400 Kilogramm schweren Akku mit 50 kWh Kapazität stecken immerhin rund 11 kg Mangan, 4 kg Lithium, 12 kg Nickel, 12 kg Kobalt und 33 kg Grafit.
Die erwartete Recyclingkapazität bis zum Jahr 2030 beträgt Schätzungen zufolge europaweit 400.000 Tonnen pro Jahr. Die Nase vorne hat Schweden, dessen Kapazitäten insbesondere durch den Batteriezellfertiger Northvolt rund 135.000 Tonnen betragen werden. Doch bevor die Akkus zerlegt und geschreddert werden, dürfen sie noch etliche Jahre im stationären Betrieb ihr Second Life verbringen.
Arbeitsplatzverlust?
Aktuell werden in den meisten Branchen händeringend Mitarbeiter gesucht, vielleicht ist das Ende der Verbrennungsmotorproduktion ja die Lösung des Arbeitskräftemangels? Denn eines ist klar: die Batteriezellproduktion ist hoch automatisiert, wird also zur Kompensation nicht ausreichen. Laut Verband der Automobilindustrie hängen in Deutschland etwa 613.000 Arbeitsplätze direkt am Verbrennungsmotor, in Europa gesamt rund 1,4 Millionen. In Österreich sind laut Fachverband 37.500 Jobs in 150 Betrieben direkt der Fahrzeugindustrie zuzurechnen (Stand 2021).
Auch das Fraunhofer Institut für System- und Innovationsforschung (ISI) hat sich mit dem Thema beschäftigt. In der Studie „Batterien für Elektroautos: Faktencheck und Handlungsbedarf“ wird festgehalten, dass der Bedarf an Batteriekapazitäten in Europa um das Jahr 2030 bei bis zu 1 TWh liegen wird. Je GWh Batteriekapazität sollten etwa 40 Arbeitsplätze direkt in der Batteriezellenherstellung und nochmals mehr als 200 Arbeitsplätze in der vorgelagerten Wertschöpfungskette für zum Beispiel Materialien, Forschung und Entwicklung, Maschinen- und Anlagenbauer usw. entstehen. Während E-PKW weniger wartungsintensiv sind, entstehen zusätzliche Stellen in den Bereichen Ladeinfrastruktur, Digitalisierung und der Energiewirtschaft. Hier ist die Politik gemeinsam mit der Branche gefordert, rechtzeitig industrie- und arbeitsmarktpolitische Maßnahmen bei der Ausbildung zu setzen. Nur so kann der Strukturwandel in Kombination mit natürlicher Altersfluktuation sozialpolitisch verträglich gestaltet werden.
Glaubt man den Ergebnissen der Fraunhofer Austria Studie „Transformation der österreichischen Fahrzeugindustrie“ sind heimische produzierende Unternehmen kaum auf den Strukturwandel hin zu Elektromobilität vorbereitet. Das Problem: sowohl die Entwicklung neuer Produkte, als auch die Umstellung der Produktionslinien sind mit hohem Kapitalaufwand verbunden. Durch technologische Abhängigkeiten wird an bestehenden Geschäftsmodellen festgehalten, auch wenn diese ein Ablaufdatum haben. Während österreichische Nachbarn schon frühzeitig mit Förder- und Unterstützungsprogramme gestartet haben, um die Attraktivität industrieller Regionen für Investoren zu steigern und Wertschöpfungsketten für die Elektromobilität aufzubauen – also Arbeitsplätze zu sichern – hinkt die österreichische Industrie hinterher.
Kostenentwicklung
In der Studie „Technologische Analyse und Veränderung der Komponentenkosten elektrifizierter Antriebssysteme bis 2035“ beleuchtete die TU Wien die zu erwartende Preisentwicklung. Während der Preis für Fahrzeuge mit Verbrennungskraftmaschine (VKM) bis 2035 voraussichtlich um 7 Prozent und jener von Plug-in-Hybriden (PHEV) sogar um 10 Prozent ansteigen wird, ist aufgrund der fortschreitenden Forschung ein Kostenrückgang von 18 Prozent bei Batterie-Elektrofahrzeugen (BEV) und sogar 29 Prozent bei Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen (FCEV) zu erwarten. Diese Tendenz trifft für leichte PKW ebenso zu wie für schwere Nutzfahrzeuge, wobei bei letzteren auch PHEVs günstiger werden. Die Studienautoren kommen zu dem Ergebnis, dass bis 2035 VKM, mit Berücksichtigung der Hybridvarianten, die dominante Antriebsvariante bleiben. Detail am Rande: laut Statistik Austria wurden 2022 in Österreich 78.567 Benziner neu zugelassen, zusammen mit 48.115 Diesel-Fahrzeugen, 34.165 Elektromobilen und 14 Fahrzeugen mit Brennstoffzelle.
CO2 ist nicht alles
Die Reduktion des CO2-Ausstoßes ist nicht das einzige, was Elektrofahrzeuge versprechen. Auch andere lokale Verschmutzungen fallen weg: Stickoxide (NOx), Schwefeloxide (SOx) und Feinstaub mit Durchmessern unter 2,5 und 10 μm (PM2,5 und PM10), die allesamt dafür bekannt sind, bei Mensch und Tier zu gesundheitlichen Problemen zu führen. Als indirektes Treibhausgas bilden Stickoxide troposphärisches Ozon. Schwefeloxide sind vor allem als Verursacher sauren Regens bekannt.
Wenigstens wird seit der verpflichtenden Einführung des Katalysators (1.1.1988 in Österreich, 1.1.1989 in Deutschland) das noch viel schädlichere Kohlenmonoxid nicht mehr direkt ausgestoßen. Weitere Vorteile im Vergleich zu Benzin- oder Dieselmotoren: es entsteht kein bodennahes Ozon (Sommersmog), auch die Überdüngung durch überschüssige Nährstoffe wie Nitrat und Phosphat findet nicht statt.
Fazit: Wie jede technologische Entwicklung bringt auch die Elektromobilität Vor- und Nachteile, Profiteure und Verlierer. Fakt ist, dass die politischen Weichen für die Zukunft in Richtung Elektromobilität gestellt sind und kein Weg daran vorbeiführt – zumindest im Personenverkehr. Durch strengere Vorgaben und Kontrollen beim Rohstoffabbau hinsichtlich ökologischer und sozialer Standards können die schädlichen Auswirkungen reduziert werden. Die nächsten Jahre werden zeigen, wie realistisch die Ziele und Vorgaben tatsächlich sind. (AG)
Quelle: LOGISTIK express Journal 1/2023